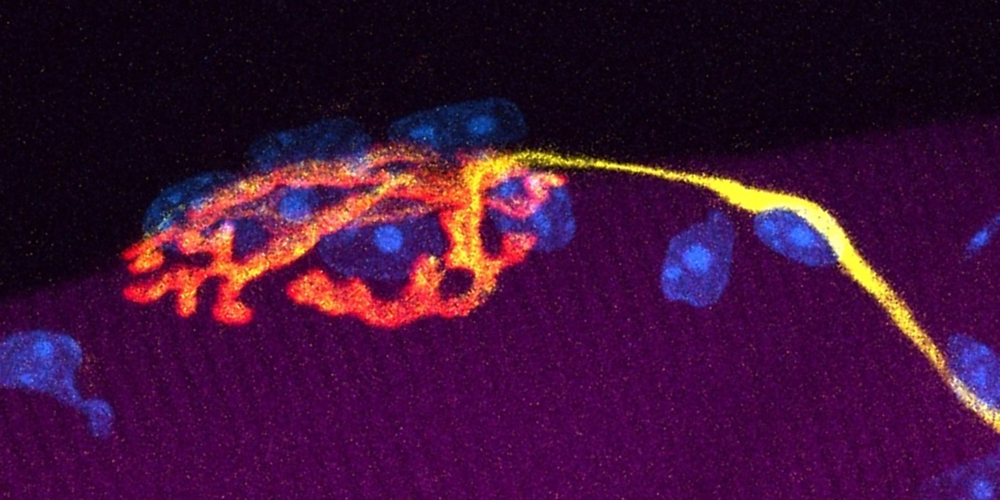Vom KZ Ravensbrück nach Basel – Bericht eines Holocaust-Überlebenden
Noch bis Ende nächster Woche läuft im Kollegienhaus die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors». Unter den Porträtierten befindet sich Ivan Lefkovits, emeritierter Professor am Basler Institut für Immunologie. Im Interview spricht er über seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und seinen Weg nach Basel.
15. Dezember 2017
Ivan Lefkovits wurde 1937 in Prešov, Slowakei, als Sohn eines Zahnarztes und einer Pharmazeutin jüdischer Abstammung geboren. Im Frühling 1939 besetzten deutsche Truppen die Tschechoslowakei und führten die Nürnberger Rassengesetze ein. Weil seine Eltern wirtschaftlich wichtig waren, war die Familie zu dem Zeitpunkt noch nicht bedroht. Doch der Schutz hielt nicht bis zum Ende des Krieges. Lefkovits floh mit seinem Vater nach Ungarn. Sie glaubten, dort eher überleben zu können. Dem war nicht so. Er kehrte allein in die Slowakei zurück und versteckte sich mit seiner Familie, bis sie schliesslich verraten wurden.
Herr Lefkovits, Sie waren sieben, als Sie und Ihre Familie 1944 von der Gestapo verhaftet wurden. Was ist dann geschehen?
Ivan Lefkovits: Ich wurde mit meinem älteren Bruder und meiner Mutter ins KZ Ravensbrück deportiert. Mein Bruder, er war 14, wurde dort von uns getrennt, weil Ravensbrück ein Frauenlager war. Er kam ins angrenzende Männerlager. Wir haben ihn nie wieder gesehen. In Ravensbrück hatten die Toten noch Namen, aber dann kam die Evakuierung nach Bergen-Belsen, teilweise durch Todesmärsche. Ich habe es nicht geschafft, und man hat mich getragen. Als wir ankamen, war es ganz anders als in Ravensbrück. Links und rechts waren Halden von Toten, meistens schon entkleidet. Das war die Begrüssung. Da war uns klar, hier gibt es kein Entrinnen. Alles war gefährlich.
Wie überlebt man so etwas?
Meine Mutter hat sich oft für Aussenkommandos gemeldet, weil sie dafür eine Extraportion Suppe erhielt. Diese hat sie mir gegeben, weil sie meinte, ich hätte es nötiger. Wenn sie nicht im Aussenkommando war, hat sie mich unterrichtet. Während dem Lernen spürt man keinen Hunger. Das ist merkwürdig, aber es ist so. Als meine Mutter gemerkt hatte, dass ich gerne lerne und gierig war Neues zu lernen, hat sie immer gesagt: «Prima, das hast du gut gemacht! Das wirst du in deinem Leben noch gebrauchen.» Diese Aussage war für mich magisch. Es bedeutete, auch wenn meine Mutter das nie aussprach, dass es ein Leben danach gibt.
Am 15. April 1945 wurde das KZ Bergen-Belsen von den Briten befreit. Welche Erinnerungen haben Sie an den Tag?
Am 4. April 1945 haben die Deutschen das Lager geschlossen, die Wasserversorgung gesprengt, den Strom abgestellt und weg waren sie. Als die Briten elf Tage später das Lager befreiten, war das Vorgefundene so unerwartet für sie, dass sie nicht imstande waren zu reagieren. Es war klar, dass die Leute Wasser brauchen. Sie hatten zu dem Zeitpunkt aber nicht die Möglichkeit, 10‘000 Leute mit Wasser zu versorgen.
Was ist danach geschehen?
Nach 48 Stunden fuhren die Briten mit Zisternenwagen auf und es war endlich genügend Wasser da. Man hat uns aus unseren Baracken getragen, gewaschen, desinfiziert und in saubere Betten gelegt – aber wir waren fast klinisch tot. Viele sind noch während dieser Prozedur gestorben. Es dauerte mehrere Monate, bis wir uns erholt hatten und in einem gesundheitlichen Zustand waren, der es uns erlaubte, in die Tschechoslowakei zurückzukehren. Das war im Juni 1945. Wir hatten die Hoffnung, dass mein Bruder und mein Vater noch am Leben waren, was sich nicht bewahrheitet hat. Am 25. Juli sind wir mit dem Zug in Prag angekommen. Die Reise durch Deutschland dauerte vier bis fünf Tage. Es war bequem, mit gutem Essen. Für uns war es sehr wichtig zu sehen, dass Deutschland völlig zerstört war. Die wollten den totalen Krieg und den haben sie bekommen.
1969 sind Sie in Basel angekommen. Was hat Sie hierher gebracht?
Meine Mutter hat ein paar Jahre nach dem Krieg wieder geheiratet. Wir sind dann aus der Slowakei nach Prag übergesiedelt. Dort habe ich Chemie studiert. 1965 habe ich vom Institut für Genetik und Biophysik in Neapel ein Stipendium gewonnen, was in sozialistischer Zeit sehr ungewöhnlich war. Von Neapel gingen wir weiter nach Frankfurt. Dort arbeitete ich am Paul-Ehrlich-Institut. Der Direktor des Instituts hat mir angeboten, mit ihm nach Basel zu kommen, um ihm beim Aufbau des neuen Instituts für Immunologie zu helfen. Ich war Gründungsmitglied und bin bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2002 am Institut geblieben.
Ihre Geschichte ist Teil der Wanderausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors», die zurzeit im Kollegienhaus der Universität Basel gezeigt wird. Was erhoffen Sie sich von der Ausstellung?
Der Holocaust war eine Entrechtung mehrerer Gruppen von Leuten, nicht nur der Juden. Die Nazis haben sich an ihrem Eigentum bedient und versucht, alle zu ermorden. Das war so monströs, dass es wirklich einzigartig ist. Das muss man erstmal verstehen, und die Ausstellung öffnet Türen und Herzen dafür. Aber man muss anschliessend etwas machen damit. Es muss etwas folgen, damit die Wirkung der Ausstellung nachhaltig ist. Es braucht das Geschriebene. Unabhängig von dieser Ausstellung habe ich deshalb bereits vor vielen Jahren Holocaust-Überlebende ermuntert, ihre Geschichte niederzuschreiben. Es entstand eine Sammlung von 15 Heften mit je einem Bericht. Das ist für mich nachhaltig.
Ivan Lefkovits (Hg.): Mit meiner Vergangenheit lebe ich. Memoiren von Holocaust-Überlebenden. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, 995 Seiten, 79 €/ 105 CHF.
Die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors» ist ein Projekt der Gamaraal Foundation. Die Ausstellung zeigt, wohin Antisemitismus, welcher heute vielerorts wieder aufflackert, führen kann und will deshalb für den Wert und die Wichtigkeit von Toleranz sensibilisieren und den Ruf des «Nie wieder» weitertragen. Sie ist noch bis am Donnerstag, 21. Dezember, im Kollegienhaus der Universität Basel zu sehen.