Unisonar S3|EP1: Sucht und Therapie
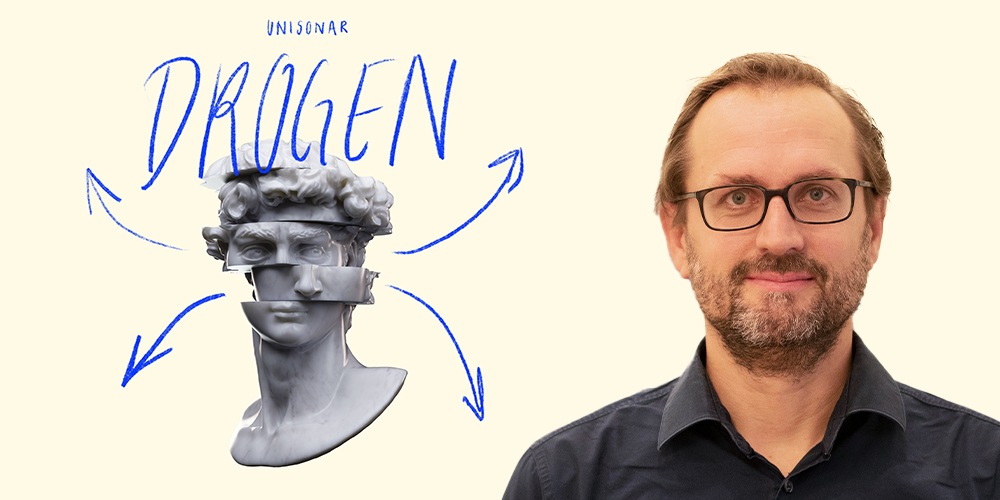
Marc Vogel, Suchtexperte und Chefarzt am Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), spricht beim Podcast Unisonar über den Umgang mit Süchtigen und Therapieformen bei Substanzabhängigkeit.
Wann sind wir süchtig – und wann sollten wir in eine Therapie? Marc Vogel, Chefarzt am zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) spricht im Podcast über die Entstehung und Behandlung von Sucht. Dabei betont er: Dabei betont er, dass Sucht multifaktoriell bedingt ist. Genetische Disposition, gesellschaftliche Einflüsse und persönliche Erfahrungen tragen gleichermassen zum Risiko einer Abhängigkeit bei. Insbesondere soziale Faktoren und traumatische Erlebnisse können in Kombination mit einer genetischen Veranlagung die Wahrscheinlichkeit einer Suchtentwicklung erhöhen.
Häufig suchen Menschen erst dann Hilfe, wenn äussere Probleme wie Beziehungsbrüche oder der Verlust des Arbeitsplatzes auftreten. Vogel wünscht sich jedoch, dass Betroffene früher handeln, beispielsweise wenn Alkohol oder andere Substanzen regelmässig zum Stressabbau genutzt werden. Der Therapieprozess beginnt in der Regel mit einer genauen Diagnose und einem Entzug, der sowohl medizinisch als auch psychotherapeutisch begleitet wird. Ziel ist es, nicht nur die Entzugssymptome zu behandeln, sondern auch langfristige Strategien zur Verhaltensänderung zu entwickeln.
Individualisierte Therapieziele und Abstinenz
Abstinenz ist nicht immer das primäre Ziel einer Suchttherapie, so Vogel. Vielmehr geht es darum, den Betroffenen zu einem selbstbestimmten und lebenswerten Leben zu verhelfen. Während bei Alkoholabhängigkeit oft Abstinenz angestrebt wird, können kontrollierter Konsum oder Konsumreduktion ebenfalls legitime Therapieziele sein. Diese Ziele werden individuell mit den Patient*innen erarbeitet und können sich im Verlauf der Behandlung ändern.
Die Behandlung variiert je nach Substanz. Während für Alkohol- und Tabakabhängigkeit vor allem Verhaltenstherapien und Medikamente eingesetzt werden, gelten bei Opioidabhängigkeit sogenannte Opioid-Agonisten-Behandlungen als effektivste Methode. Vogel betont, dass die langfristige Behandlung mit Substitutionsmedikamenten nicht nur Rückfälle verhindert, sondern auch die Lebensqualität der Betroffenen erheblich verbessert. Auch Verhaltenssüchte wie Spielsucht oder Onlinesucht werden in den UPK behandelt, wobei hier die Schwerpunkte auf psychotherapeutischen Ansätzen liegen.
Prävention und gesellschaftliche Verantwortung
Besondere Sorge bereiten Vogel die gesellschaftlichen Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum, die trotz ihrer Legalität massive Schäden verursachen. Er plädiert für strengere Regulierungen wie ein Werbeverbot oder den Verkauf in spezialisierten Geschäften. Gleichzeitig sieht er die Regulierung illegaler Substanzen wie Cannabis oder sogar Kokain als eine Möglichkeit, den Schwarzmarkt einzudämmen und Betroffenen besseren Zugang zu Hilfsangeboten zu verschaffen.
Abschliessend hebt Vogel hervor, wie wichtig es ist, frühzeitig Warnsignale zu erkennen – sowohl für Betroffene selbst als auch für Angehörige. Die Stigmatisierung von Suchterkrankungen erschwert oft den Zugang zu Hilfe. Daher ist es entscheidend, Sucht als komplexes Krankheitsbild zu verstehen und individuell abgestimmte Behandlungswege zu fördern.


