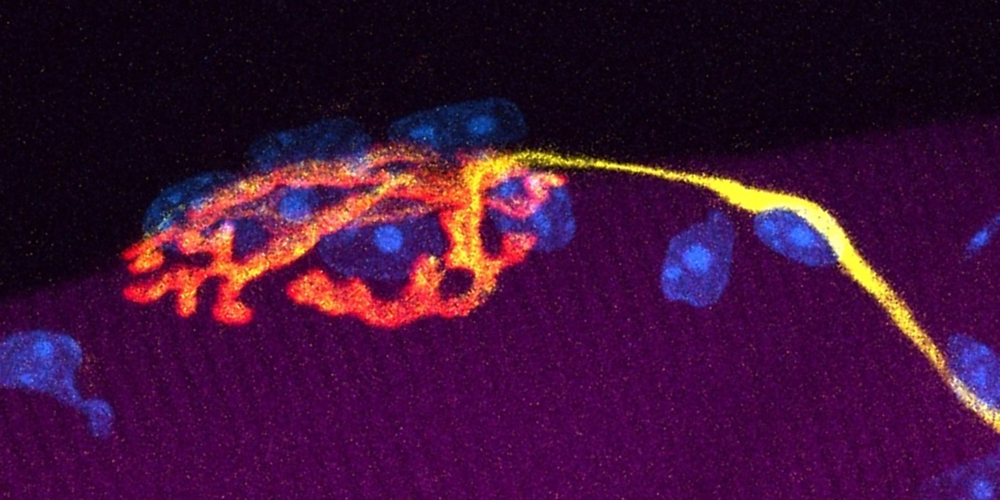Universität Basel: Erfolgreich in der Forschung – Herausforderungen bei der Finanzierung
Die Universität Basel schliesst ihre Rechnung 2015 bei einem Aufwand von 745,1 Millionen Franken mit einem Verlust von 16,4 Millionen Franken ab. Nach starken Wachstumsjahren sind die Studierendenzahlen im 2015 immer noch leicht steigend. Die Universität Basel ist weiterhin für Studierende aus anderen Kantonen interessant und im Bereich der Doktorierenden ist Basel eine attraktive Adresse. Äusserst erfolgreich war die Universität Basel in der Gewinnung von Drittmitteln.
25. April 2016
Im Rechnungsjahr 2015 weist die Universität Basel einen Gesamtaufwand von 745,1 Millionen Franken aus, dem Erträge von 728,7 Millionen Franken gegenüberstehen, woraus ein Minus von 16,4 Millionen Franken resultiert. Dieses Defizit wird primär durch die einmalige arbeitgeberseitige Einlage in die Pensionskasse aufgrund der Planumstellung (Besitzstandskosten von 15,2 Mio. Franken) verursacht und geht zulasten des Eigenkapitals der Universität Basel.
Die Trägerkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft finanzieren mit 325,1 Millionen Franken 46,0% des Gesamtertrags. Der Bund steuert gemäss Universitätsförderungsgesetz 96,0 Millionen Franken oder 13,5% bei. Weitere 10,3% kommen von Kantonen, die Studierende nach Basel schicken und dafür gemäss der interkantonalen Universitätsvereinbarung 73,3 Millionen Franken beitragen.
158,6 Millionen Franken oder 22,3% der gesamten Erträge stammen aus kompetitiv eingeworbenen Mitteln wie Projektzusprachen des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und internationalen Forschungsprogrammen, aus speziellen Bundesprogrammen und weiteren zweckgebundenen Forschungszusprachen sowie von privaten Dritten. Schliesslich entfallen 7,8% der Erträge (55,5 Millionen Franken) auf Gebühren, Dienstleistungen und auf den Vermögenserfolg.
Das zweite Jahr der Leistungsperiode 2014–2017 zeigt, dass sich wichtige Indikatoren in Lehre und Forschung positiv entwickeln. Die Einwerbung von Drittmitteln hat sich mit insgesamt 158,6 Mio. Franken erfreulich entwickelt, das Rekordjahr 2010 (159,3 Mio. Franken) wurde nur knapp verfehlt. Diese Zahlen sprechen für die ungebrochen grosse Leistung der Forschenden der Universität Basel.
Herausforderungen für die Finanzierung
In den kommenden Monaten stehen für die Universität Basel existenzielle Entscheide an. Bis im Herbst 2016 muss die gesamtuniversitäre Planung und der daraus resultierende Finanzierungsantrag für die Leistungsperiode 2018–2021 vom Universitätsrat verabschiedet und den Trägerkantonen Basel-Stadt und Baselland überreicht werden. Im 2017 wird eine entsprechende Leistungsvereinbarung ausgearbeitet und muss von den Parlamenten verabschiedet werden, damit sie per 1. Januar 2018 in Kraft treten kann.
Universitätsratspräsident Dr. Ueli Vischer zeigte sich erfreut über die Entwicklung der Drittmittel an der Universität Basel: «Im nationalen Vergleich liegen wir mit einem Anteil von einem knappen Viertel der Erträge ganz vorne», so Vischer. Immer wichtiger werden die Mittel, welche die Universität Basel aus EU-Forschungsprogrammen generieren kann. Vier im 2015 beim ERC (European Research Council) eingereichte Projekte erhielten kürzlich den Zuschlag – mehrere Millionen Forschungs-Euros fliessen so in die Forschung der Universität Basel.
Hohe Wertschöpfung der Universität Basel
Prof. Andrea Schenker-Wicki, seit 1. August 2015 Rektorin, hat sich zum Ziel gesetzt, die Universität Basel trotz Sparanstrengungen von Bund und Kantonen auf höchstem Niveau zu halten. «In den wichtigen Rankings von Shanghai und Times Higher Education sind wir regelmässig in den Top 100», betont Schenker-Wicki, «und diese Plätze wollen wir verteidigen». Als wichtiges Feld für die Zukunft definierte die neue Rektorin den Bereich Innovation und Technologietransfer: «Die Universität Basel bekommt viel von der Gesellschaft, darum muss sie auch alles daran setzen, dass sie auch etwas zurückgeben kann.» Wie gut sich Investitionen in die Universität Basel rentieren, zeigt eine Studie zur Wertschöpfung, die von BAK Basel erstellt wurde. «Jeder bei uns investierte Franken wird verdreifacht», so Andrea Schenker-Wicki, «die Universität Basel ist damit einer der wichtigen Motoren des erfolgreichen Wirtschaftsraums Nordwestschweiz».
Bauprojekte rasch realisieren
In den nächsten Jahren wird es von zentraler Bedeutung sein, dass sowohl die bereits laufenden als auch die noch anstehenden grossen Bauprojekte rasch realisiert werden können. «Wir sind darauf angewiesen, dass wir unsere Campusplanung umsetzen und in der Forschung und Lehre moderne Infrastrukturen zur Verfügung stellen können», betont Verwaltungsdirektor Christoph Tschumi. Die Universität Basel müsse in den kommenden Jahren in ihre Liegenschaften investieren, um die aktuell sehr gute Positionierung im Wettbewerb zwischen den Universitäten um exzellente Forschende, kompetitive Drittmittel und Studierende halten zu können.
Vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat
Der Kanton Basel-Stadt hat seine Pensionskasse per 1. Januar 2016 reformiert und vom Leistungs- zum Beitragsprimat umgestellt. Gleichzeitig wurde der technische Zinssatz von 4 auf 3 Prozent gesenkt. Der Universität Basel sind einmalige Kosten in der Höhe von 63 Millionen Franken entstanden. Eine grosse Last dieser Umstellung tragen die Versicherten selbst, indem sie sich zur Hälfte an diesen Kosten beteiligen müssen. Dadurch werden die beim Arbeitgeber Universität und damit bei den Trägerkantonen verbleibenden einmaligen Kosten deutlich reduziert. Die befristet angestellten Mitarbeitenden sind bereits seit längerem dem Beitragsprimat unterstellt und darum von diesen Änderungen nicht betroffen.
Die Beteiligung des Arbeitgebers an den einmaligen Besitzstandkosten in der Höhe von 15,2 Mio. infolge der Planänderungen bei der Pensionskasse Basel-Stadt führte im Jahr 2015 zu einem negativen Ergebnis und damit einer entsprechenden Reduktion des freien Eigenkapitals. Die Beteiligung des Arbeitgebers an den einmaligen Kosten beim Vorsorgekapital der Rentenbeziehenden in der Höhe von voraussichtlich rund 16 Mio. Franken wird im 2016 zusätzlich das freie Eigenkapital der Universität belasten. Damit wird der bisher schon beschränkte – aber aus Sicht der Universität dringend notwendige – finanzielle Handlungsspielraum für die Folgejahre sehr eingeschränkt. Die Universität ist auf dieser Basis nur noch beschränkt in der Lage, auf kurzfristige Entwicklungen und Opportunitäten im flexibel und gezielt zu reagieren. Damit die Universität handlungsfähig bleibt, haben die Parlamente der beiden Trägerkantone eine Stärkung des freien Eigenkapitals mit Einlagen von 3 Mio. Franken pro Jahr und Träger im Zeitraum 2017 bis 2021 beschlossen (insgesamt 30 Mio. Franken). Die SVP Basel-Landschaft hat dagegen das Referendum ergriffen.
Weitere Auskünfte
Matthias Geering, Universität Basel, Leiter Kommunikation & Marketing, Tel. +41 61 267 35 75, mobil: +41 79 269 70 71, E-Mail: matthias.geering@unibas.ch