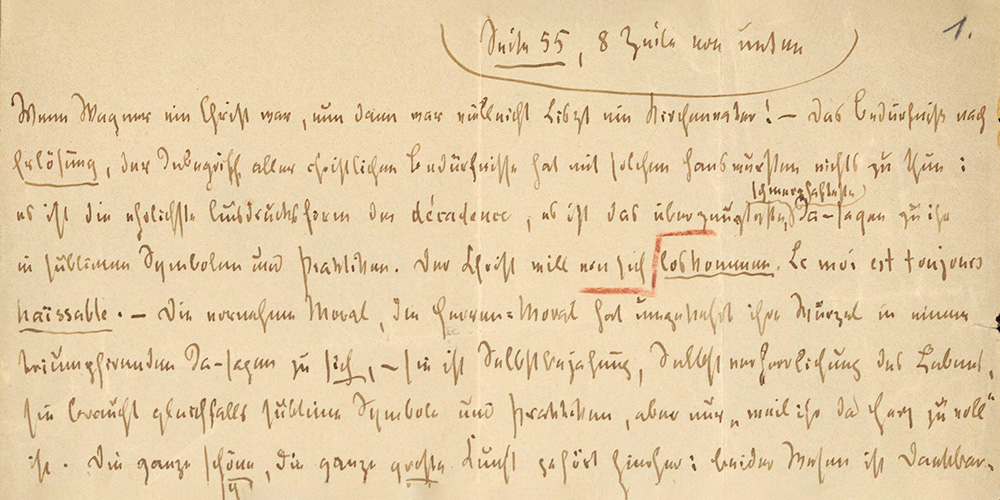Basler Wohnbauausstellung vor 90 Jahren: Architektur und Gesellschaft
Die Ideen des Neues Bauens bestimmten 1930 die erste Schweizerische Wohnungsausstellung (WOBA) in Basel. Doch die hier vorgestellten modernen Wohnformen für die Massen waren stark umstritten. Eine Historikerin untersucht in einer Fallstudie die Reaktionen in den Medien auf die Ausstellung und wie sie die damaligen gesellschaftlichen Vorstellungen widerspiegelten.
25. Mai 2020
Armut, schlechte Hygieneverhältnisse, Wohnungsnot, Obdachlosigkeit – mit diesen Problemen kämpfte die Stadt Basel in den Zwischenkriegsjahren. Der Staat war gefordert, neue, effiziente Bau- und Wohnkonzepte zu finden, um die Situation für die unteren Gesellschaftsschichten zu verbessern. Die WOBA, organisiert von Architekten des Neuen Bauens, versuchte Lösungen für dieses Problem zu finden. Bestehend aus einer Hallenausstellung in der Messe und einer Ausstellungssiedlung auf dem Eglisee-Gelände, stellten diese Architekten ihre experimentellen Ideen vor. Die Umsetzung der Vorschläge nicht nur auf dem Papier, sondern «im echten Leben», sollte es ermöglichen, Räume und Grundrisse direkt vergleichen und gegeneinander abwägen zu können.
Die Häuser der Ausstellung auf dem Eglisee-Gelände waren schlicht konzipiert und zeigten, wie Wohnen am Existenzminimum aussehen konnte. «Hier war alles aufs Wesentliche reduziert, womit einerseits Baukosten gespart und anderseits der Aufwand für die Instandhaltung so klein wie möglich gehalten werden sollte», sagt die Historikerin Rhea Rieben. Ihre Forschung konzentriert sich auf den Schweizer Architekten Hans Schmidt, der mit Berufskollegen wie Hannes Meyer als Vertreter der sozialistisch inspirierten Bewegung des Neuen Bauens gilt.
Wo soll die Gesellschaft hin?
«Diese Generation von Architekten war getrieben von gesellschaftspolitischen Fragen und hatte den Anspruch, zu einem besseren Leben für die Bevölkerung beizutragen», erläutert Rieben. «Mit einem starken Sendungsbewusstsein wollten sie ihre Ideen in die Gesellschaft hineintragen.» Wohnungsbau und Sozialpolitik waren zudem eng miteinander verknüpft, weshalb die WOBA von staatlicher Seite finanziell unterstützt wurde. War eine Stadtregierung eher links ausgerichtet, wie etwa in Basel, Zürich oder Biel, hatten genossenschaftliche Projekte bessere Chancen, sagt die Historikerin.
Dass die Zwischenkriegszeit eine gesellschaftlich turbulente Zeit war, lasse sich anhand der WOBA gut darstellen. Rieben nahm die Medienberichterstattung über die Ausstellung unter die Lupe: Dabei kann sie zeigen, dass sich anhand von Architektur und Möblierung Debatten über die Zukunft der Gesellschaft entfachten – vor allem über jene der Arbeiterklasse. Diese war seit dem Landesstreik von 1918 in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt - auf politischer Ebene waren dringend Veränderungen nötig.
Architektur und individuelles Denken
Während die Arbeiterzeitung «Das Volk» den vorgeschlagenen Massenwohnungsbau lobte, weil dieser der Lebensrealität des Proletariats entspreche, sahen andere in diesen Bauten demokratische Grundprinzipien bedroht. Wie könne die Familie als «Grundzelle» der Gesellschaft unter solch beengenden Verhältnissen gestärkt werden? «Das Heim und mit ihm die Einheit der Familie war für die Entwicklung zu einem gesellschaftlich wertvollen Individuum in der damaligen Vorstellung zentral. Wenn dieses Heim nun keinen Platz mehr zur Entfaltung biete, so die Argumentation, drohe die schweizerische Gesellschaft auseinanderzubrechen», erklärt Rieben.
Wieder andere Medien jener Zeit sahen in den rationalisierten Gemeinschaftsbauten die zukünftige Lebenswelt der Arbeiterklasse und lobten etwa die beruhigende Wirkung der minimalen Ausstattung der Bauten. Und nicht zuletzt kam in den Debatten um die WOBA auch die Angst vor dem Kommunismus zum Ausdruck: Was, wenn die einheitlichen Wohnräume zu einer Gleichschaltung der Bürgerinnen und Bürger führen? Würde das die Gesellschaft nicht in die falsche Richtung lenken, dem Kommunismus Tür und Tor öffnen?
Spannungen zwischen West und Ost
Die Analyse der Historikerin zeigt anhand der Basler Wohnungsausstellung, wie über das Wohnen unterschiedliche Auffassungen von Individualität und Familie in der Schweiz der Zwischenkriegszeit verhandelt wurden. Sichtbar wird zudem, in welchem Spannungsverhältnis sich die Konzepte des Neuen Bauens entwickelten. Dieses findet sich nicht zuletzt auch in der Biografie von Hans Schmidt: «In den 1930er Jahren wurden er und viele andere Architekten in die Sowjetunion eingeladen, um ihre Ideen für den Massenwohnungsbau und moderne Städteplanung einzubringen», sagt Rieben.
Verwirklicht und noch heute zu sehen sind diese Ideen übrigens im Eglisee-Quartier, zum Beispiel im Haus Im Surinam, das von Hans Schmidt und Paul Artaria anlässlich der WOBA entworfen wurde. Mit seinen minimalen 45 Quadratmetern war der Bau für eine vierköpfige Familie konzipiert, und die Jahresmiete für diesen Haustyp betrug weniger als 900 Franken – beides Dimensionen, die heute in der Schweiz wohl kaum mehr vorstellbar sind.