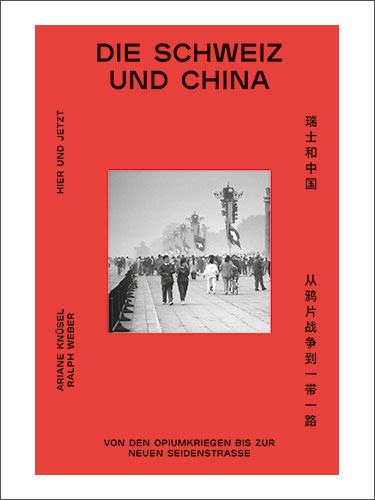Die Schweiz und China: «Beide Länder wollen voneinander profitieren.»
Seit Jahrhunderten unterhalten die Schweiz und China Wirtschaftsbeziehungen und kulturelle Kontakte – geprägt auch von kritischen Phasen. Die Historikerin Ariane Knüsel ist Mitautorin einer neuen Publikation über das Verhältnis der beiden Länder.
26. August 2024 | Christoph Dieffenbacher
Frau Knüsel, auf den ersten Blick könnten die Schweiz und China nicht unterschiedlicher sein. Was verbindet den kleinen, neutralen Staat mitten in Europa und das Riesenreich im Osten?
Das Gemeinsame liegt vor allem darin, dass sich die beiden Länder ergänzen und voneinander profitieren konnten: hier die Schweiz mit ihrer früh hochentwickelten Technologie, dort das bevölkerungsreiche China mit seinem grossen Absatzmarkt. Das begann schon im 17. Jahrhundert, als mit den Missionaren die ersten Westschweizer Uhrmacher China besuchten. Dort war man fasziniert von den präzisen Uhrwerken – und das ist bis heute so. Es gibt aber auch kuriose Verbindungen: So wurde der Kampf Chinas gegen Japan im Zweiten Weltkrieg in der Schweizer Presse mit jenem der Eidgenossen gegen den übermächtigen Feind verglichen.
Gab es in der Beziehung Phasen von Hochs und Tiefs, von Nähe und Distanz?
Lange interessierte man sich nicht besonders füreinander. Doch die frühe Anerkennung der Volksrepublik durch die Schweiz 1950 wird dort noch heute vielfach gelobt. Das neutrale Land galt in der Volksrepublik China immer als weniger problematisch als etwa die USA oder Grossbritannien.
Die Schweiz wird daher bis heute eher vorteilhaft behandelt, auch bei Wirtschaftsabkommen. Zu den Tiefpunkten gehören die diplomatische Krise während der Kulturrevolution 1967 und der Eklat beim Staatsbesuch von Staatspräsident Jiang Zemin in Bern 1999. Beide Male ging es übrigens um Tibet und um Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz.
Interessierten sich die beiden Länder nur aus wirtschaftlichen Gründen für ihr Gegenüber?
China ist in erster Linie an Technologie und Know-how interessiert, die Schweiz an Absatzmärkten. Im Kalten Krieg benutzte China die Schweiz als Spionagezentrum im Westen, während man sich hier durch die guten Beziehungen zur Volksrepublik als neutraler Mediator bei Konflikten profilieren konnte. Noch heute ist die Schweiz bei Sanktionen gegen China äusserst zurückhaltend. Sie versteht sich in ihrem Selbstbild vor allem als Brückenbauerin – und steht im Dilemma zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechtsfragen.
Spielten im Kalten Krieg nicht auch Ängste vor Bedrohungen mit, die vom kommunistischen China ausgehen?
Doch, ganz stark. In der Schweiz gab es bereits um 1900 Warnungen vor der «gelben Gefahr» aus China. Daraus wurde im Kalten Krieg die «rote Gefahr». UNO-Beamte, Kommunisten und sogar China-Restaurants gerieten in den 1950er-Jahren immer wieder unter Spionageverdacht. In dieser antikommunistischen Stimmung wurden auch Persönlichkeiten wie der Kabarettist und Politiker Alfred Rasser boykottiert, weil sie nach China gereist waren. Das änderte sich erst mit der Öffnung Chinas Ende der 1970er-Jahre, als dort immer mehr Schweizer Unternehmen Fuss fassen wollten. Damals wurden sogar Simmentaler Kühe nach China exportiert – ein kaum bekanntes Detail, auf das wir bei unseren Recherchen zum Buch gestossen sind.
Neben der Wirtschaft wirkt der kulturelle Austausch zwischen den Ländern oft etwas aufgesetzt. Täuscht dieser Eindruck?
Nein, das kann man durchaus so sehen. Seit den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert sind zwar Memoiren von Schweizer Chinareisenden und Missionaren erhalten, die sich auf die traditionelle Kultur des Landes einliessen. Später kamen hierzulande Phänomene wie Akupunktur und Tai Chi in Mode.
Im Gegenzug sollen chinesische Minister von der Schönheit der helvetischen Landschaft zu Gedichten inspiriert worden sein. Aber trotz Tourneen der Peking-Oper in der Schweiz und spontanen musikalischen Darbietungen von Franz Hohler und Polo Hofer in China blieb ein gegenseitiges kulturelles Verständnis eher beschränkt. In letzter Zeit sehen wir hierzulande allerdings eine grosse Zunahme des Massentourismus aus China.
Wie sehen die gegenseitigen Bilder und Stereotype in den beiden Ländern aus?
In der Schweiz ist das Bild des chinesischen Drachens verbreitet, der bereits Geschirr, Möbel und Vasen schmückte, als im 18. Jahrhundert in bürgerlichen Stuben die Chinoiserie aufkam. Heute stellt der Drache in schweizerischen Karikaturen eine Bedrohung dar. Umgekehrt wird die Schweiz in China oft als der «Garten Europas» bezeichnet, was eindeutig positiv konnotiert ist. Der Fokus liegt aber weiterhin auf stereotypen Exportschlagern: Während zum Beispiel ein Globi-Band von Kung Fu und dem Essen mit Stäbchen erzählt, bringt ein chinesischer Comic den Kindern das Alpenland mit einer rasanten Schatzsuche nahe – inklusive gefährlichen Gletschertouren und gemütlichen Fondueessen.